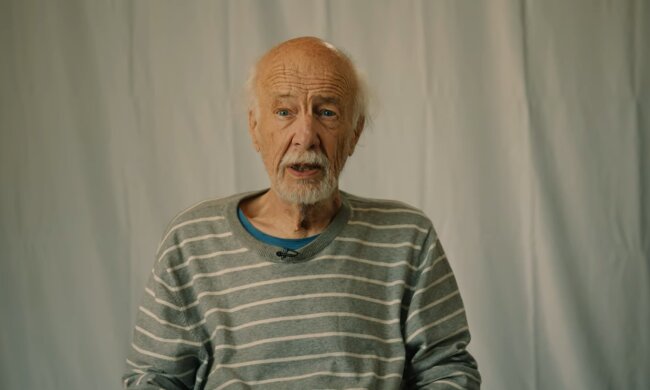In den Schaufenstern europäischer Einkaufsstraßen glänzen die neuesten Kollektionen von Zara, H&M oder Mango. Die Preise sind dort zwar nicht immer niedrig, doch der eigentliche Skandal steckt hinter den Kulissen: Ein Großteil dieser Kleidung wird in Ländern wie Bangladesch gefertigt – von Menschen, die für einen Hungerlohn schuften.
Bangladesch zählt zu den größten Textilproduzenten der Welt. Mehr als vier Millionen Menschen arbeiten in der Bekleidungsindustrie, die zu den wichtigsten Einnahmequellen des Landes gehört. Doch die Arbeitsbedingungen sind hart: Schichten von bis zu zwölf Stunden, kaum Pausen und oft gefährliche Fabrikhallen sind keine Seltenheit. Der durchschnittliche Monatslohn einer Näherin liegt zwischen 80 und 120 Euro – weit entfernt von einem existenzsichernden Einkommen.

Auf der anderen Seite stehen die internationalen Modeketten. In Europa werden die Kleidungsstücke oft für das Zehn- bis Zwanzigfache des Produktionspreises verkauft. Ein T-Shirt, das in Bangladesch für wenige Euro hergestellt wird, kostet im Laden 25 Euro oder mehr. Der Gewinn fließt dabei vor allem in die Taschen der Konzerne, während die Menschen am Anfang der Lieferkette kaum profitieren.
Tragische Vorfälle wie der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza im Jahr 2013, bei dem mehr als 1.100 Arbeiterinnen und Arbeiter ums Leben kamen, haben die Missstände weltweit ins Bewusstsein gerückt. Zwar haben viele Unternehmen seitdem Versprechen abgegeben, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, doch in der Realität hat sich nur wenig verändert.
Die Verantwortung liegt nicht allein bei den Konzernen, sondern auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Wer billige Mode kauft, unterstützt indirekt das System, das auf Ausbeutung basiert. Alternativen sind Fair-Trade-Labels, nachhaltige Marken oder Second-Hand-Kleidung – Wege, die zumindest einen kleinen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit in der Modeindustrie leisten können.

Fazit: Hinter jedem Kleidungsstück steckt eine Geschichte – oft eine von harter Arbeit, geringen Löhnen und fehlender Wertschätzung. Während in Europa teure Preise verlangt werden, bleibt den Näherinnen in Bangladesch kaum mehr als ein Leben am Existenzminimum. Mode hat ihren Preis – und den zahlen meistens die Falschen.
Das könnte Sie auch interessieren: