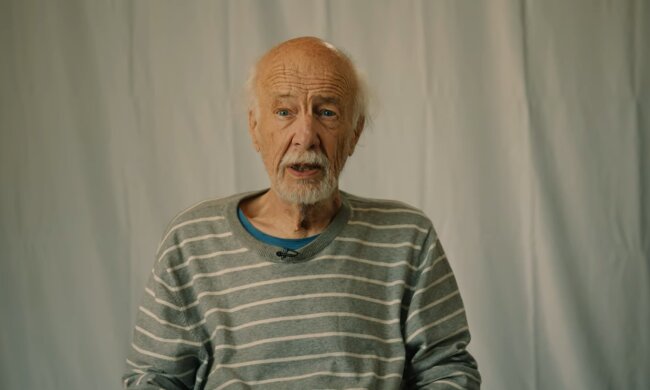Maria ist 62 Jahre alt und stolze Großmutter eines sechsjährigen Jungen namens Leon. Sie liebt ihren Enkel über alles – seine neugierigen Fragen, sein Lachen, seine kleinen Umarmungen. Doch in letzter Zeit spürt sie einen wachsenden Druck: Ihre Tochter wirft ihr vor, sich zu wenig Zeit für Leon zu nehmen.
Maria ist verletzt. „Ich liebe meinen Enkel, aber ich habe auch mein eigenes Leben“, sagt sie. Seit ihrer Pensionierung genießt sie es, wieder mehr Zeit für sich zu haben: sie reist, trifft Freunde, besucht Yoga-Kurse. Für sie bedeutet das kein Desinteresse an ihrer Familie – sondern endlich die Freiheit, sich selbst nicht mehr ganz hinten anzustellen.

Doch für ihre Tochter Anna ist das schwer zu verstehen. Als berufstätige Mutter ist sie oft erschöpft und wünscht sich, dass ihre Mutter mehr einspringt – als Babysitter, Zuhörerin, Bezugsperson für Leon. In ihren Augen hat Maria die „Pflicht“, als Oma da zu sein.
Dieses Spannungsfeld ist keine Seltenheit. Immer mehr Großeltern stehen heute zwischen zwei Welten: Einerseits die traditionelle Erwartung, für Kinder und Enkel da zu sein – andererseits der berechtigte Wunsch, die eigene Zeit selbst zu gestalten.
Familienberaterinnen raten in solchen Fällen vor allem zu offenem Dialog. Niemand sollte sich schuldig fühlen – weder die Tochter, die Unterstützung braucht, noch die Großmutter, die ihre Grenzen wahrt. „Es geht um Balance“, sagt Familientherapeutin Karin Lenz. „Großeltern dürfen Nein sagen, ohne dass das Liebe schmälert. Und Kinder dürfen sich Unterstützung wünschen, ohne Vorwürfe zu machen.“

Maria und Anna haben schließlich einen Kompromiss gefunden: Ein fester Nachmittag pro Woche gehört Leon. Der Rest bleibt frei für Marias Pläne. So entsteht Raum für Verlässlichkeit – und gleichzeitig für Freiheit.
Denn Liebe zeigt sich nicht nur in Stunden, sondern in Aufmerksamkeit, Verständnis und dem ehrlichen Willen, füreinander da zu sein – ohne sich selbst dabei zu verlieren.
Das könnte Sie auch interessieren: