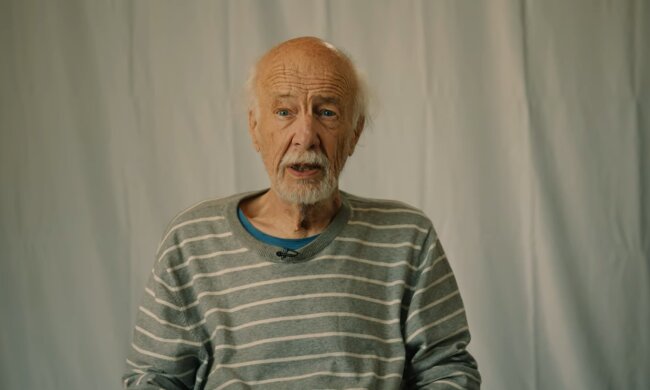Sabine M., 55 Jahre alt, hat ihr Leben lang gearbeitet. Als Verkäuferin, später in der Pflege, manchmal im Schichtdienst, manchmal mit zwei Jobs gleichzeitig. Über drei Jahrzehnte hat sie Steuern gezahlt, Beiträge eingezahlt, sich bemüht, „ihren Teil“ zu leisten.
Doch jetzt ist Schluss.
„Ich sehe nicht ein, warum ich weiter schuften soll, während der Staat mit meinem Geld Schulden macht“, sagt sie. Ihre Stimme klingt ruhig, aber fest. „Ich habe mein Leben lang ehrlich gearbeitet – und trotzdem reicht es hinten und vorne nicht. Und dann sehe ich, wofür Milliarden ausgegeben werden. Da mache ich nicht mehr mit.“
Sabine lebt in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Ihr Mann ist seit einigen Jahren in Rente, sie selbst hat ihren Job im vergangenen Jahr aufgegeben. „Ich hätte weitermachen können“, erzählt sie. „Aber irgendwann dachte ich: Wofür eigentlich?“

Sie fühlt sich ausgebrannt – nicht nur körperlich, sondern auch gesellschaftlich. „Ich habe das Gefühl, wir, die normalen Leute, zahlen immer drauf. Wir sparen, verzichten, arbeiten – und andere machen Schulden, die wir dann wieder begleichen sollen.“
Sabine lebt jetzt bescheidener, hat ihre Ausgaben reduziert, verkauft vieles, was sie nicht braucht. „Ich will frei sein“, sagt sie. „Ich will nicht mehr das Gefühl haben, dass meine Arbeit nur Löcher stopft, die ich nicht verursacht habe.“

Natürlich, sie weiß, dass ihre Entscheidung nicht jeder versteht. „Viele nennen mich faul“, sagt sie. „Aber faul ist jemand, der nie gearbeitet hat – nicht jemand, der irgendwann sagt: Es reicht.“
Ihr Satz klingt hart, aber er steht für ein wachsendes Gefühl vieler Menschen in ihrem Alter: die Erschöpfung nach Jahrzehnten der Pflicht, der Frust über politische Entscheidungen, die gefühlte Ungerechtigkeit zwischen Leistung und Anerkennung.
Sabine sagt, sie sei nicht gegen Arbeit – nur gegen das System, das sie als selbstverständlich betrachtet. „Ich habe meinen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran.“
Das könnte Sie auch interessieren: