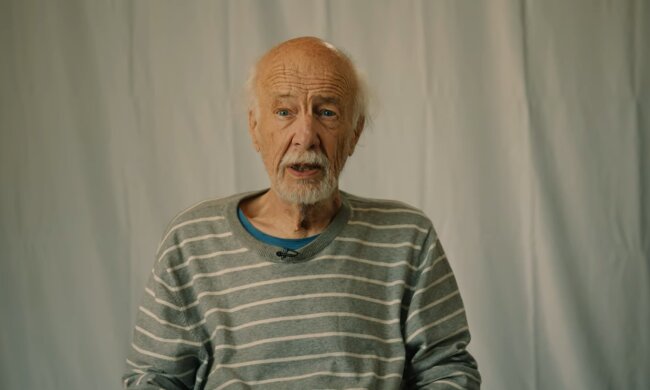In Deutschland rumort es — nicht laut, aber spürbar. Vielen Menschen erscheint es so, als ob zwar das Einkommen steigt oder zumindest stabil ist, zugleich aber das Geld gefühlt weniger wert wird. Wenn man die Stimmungslage und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammennimmt, erscheint es plausibel, dass bis zu 80 Prozent der Deutschen mit ihrer individuellen Kaufkraft zumindest teilweise unzufrieden sind.
Ursachen für Unzufriedenheit
1. Inflation frisst das nominale Einkommen
Zwar prognostiziert die Studie der GfK für das Jahr 2025 eine nominale Pro‑Kopf‑Kaufkraft von etwa 29.566 Euro, ein Zuwachs von rund 2 % gegenüber dem Vorjahr. stil & markt+4NIQ+4Gabot.de+4
Doch der entscheidende Punkt: Wenn die Verbraucherpreise schneller steigen als das Einkommen, bleibt real weniger Kaufkraft übrig. Die Studie selbst weist darauf hin, dass das nominale Wachstum „deutlich moderater“ ausfällt und reale Verluste möglich sind. DIE WELT+1

Viele Menschen spüren genau das: Zwar kommt mehr Geld rein, aber gleichzeitig steigen Ausgaben für Wohnen, Energie, Lebensmittel – so dass das Gefühl entsteht: „Ich habe nicht wirklich mehr Spielraum“.
2. Regionale Unterschiede und Verteilungsungleichheit
Die Kaufkraftverteilung in Deutschland ist stark unterschiedlich — je nach Region, Stadt‑Land‑Lage oder Einkommen. So haben etwa Bewohner*innen im Landkreis Starnberg deutlich höhere Ausgabemöglichkeiten als im bundesweiten Durchschnitt. NIQ+1
Wenn also ein großer Teil der Bevölkerung in Regionen lebt, in denen die Preise überdurchschnittlich hoch sind oder Einkommen hinter den Anforderungen zurückbleiben, fühlen sie sich benachteiligt.
3. Erwartung vs. Realität: Der „gefühlte“ Rückgang
Wohlstand wird oft subjektiv bewertet. Selbst wenn statistisch gesehen die nominale Kaufkraft steigt, fühlen sich viele Menschen so, als stünde das Geld nicht zur Verfügung – weil wichtige Ausgaben sich erhöhen, Rücklagen schrumpfen oder größere Anschaffungen aufgeschoben werden. Eine Umfrage zeigt etwa, dass viele Sparer ihre Rücklagen für unzureichend halten, was wiederum ein Hinweis auf Unzufriedenheit mit dem finanziellen Spielraum ist. DIE WELT
Warum „80 Prozent“ eine plausible Zahl sein könnten
Auch wenn keine genaue Studie diese Zahl belegt, lässt sich argumentieren:
-
Wenn ein Großteil der Bevölkerung reale Einschränkungen beim Lebensstandard empfindet (z. B. höhere Kosten, weniger Reserve, weniger Spielraum für Freizeit)
-
Wenn die Erwartungen an Einkommen, Wohlstand oder Sicherheit höher sind als das, was viele erreichen
-
Wenn zudem die Verteilungsungleichheit und regionale Unterschiede stark sind, sodass viele das Gefühl haben, nicht mitzuhalten
… dann ist eine Unzufriedenheitsrate von um die 80 % durchaus denkbar — zumindest in dem Sinne, dass viele Menschen teilweise mit ihrer Kaufkraft unzufrieden sind (nicht zwingend vollständig).

Auswirkungen dieser Unzufriedenheit
-
Konsumzurückhaltung: Menschen könnten größere Anschaffungen aufschieben, sparen statt ausgeben – was wiederum das Wirtschaftswachstum bremsen kann.
-
Soziale Stimmung: Wenn viele das Gefühl haben, nicht ausreichend ausgestattet zu sein, wächst die Unzufriedenheit mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – was sich auch in politischen Entscheidungen niederschlagen kann.
-
Ungleichheit verstärkt: Wer sich finanziell weniger Spielraum wünscht, wird bei steigenden Preisen oder unsicheren Lebensverhältnissen schneller belastet.
Fazit
Auch wenn die Statistik eine durchschnittlich steigende nominale Kaufkraft zeigt, stimmt das Bild für viele Menschen nicht mit ihrem Erleben überein. Die Nähe zur Realität – mit steigenden Kosten, Wohnraum‑Engpässen und Unsicherheit – führt dazu, dass eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung sich mit ihrer Kaufkraft nicht zufrieden fühlt. Die Zahl „80 Prozent“ ist damit nicht wissenschaftlich belegt, aber sozial plausibel und verdeutlicht das Ausmaß der Stimmung.
Das könnte Sie auch interessieren: