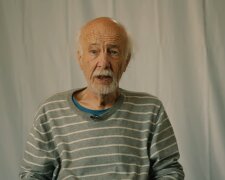Buchweizen klingt nach einem uralten Korn, dabei ist er botanisch gesehen gar kein Getreide, sondern ein sogenanntes Pseudogetreide. Reich an Eiweiß, glutenfrei und mit nussigem Aroma – eigentlich bringt er alles mit, um in einer Zeit voller Ernährungs- und Gesundheitsbewusstsein beliebt zu sein. Und doch: In großen Teilen Europas fristet Buchweizen ein Nischendasein.
Historische Gründe
Buchweizen wurde im Mittelalter über Asien nach Europa gebracht und war lange Zeit ein wichtiges „Arme-Leute-Essen“. Vor allem in Osteuropa und Russland ist er bis heute als „Gretschka“ oder „Kasza gryczana“ fester Bestandteil der Küche. In Westeuropa hingegen wurde er spätestens mit dem Aufstieg von Weizen, Roggen und Kartoffeln zurückgedrängt. Der schlechte Ruf als „Hungergetreide“ blieb hängen.

Kaum Teil der westlichen Esskultur
Während in Frankreich die Bretagne ihre berühmten Buchweizen-Crêpes („Galettes“) pflegt und in Polen oder Litauen Buchweizenbrei alltäglich ist, hat man in Deutschland, Italien oder Spanien kaum Berührungspunkte. Dort dominieren Nudeln, Kartoffeln und Weizenbrote – Buchweizen wirkt exotisch und ungewohnt.
Der Geschmack – ungewohnt herb
Viele Menschen empfinden den kräftig-nussigen Geschmack von Buchweizen als „gewöhnungsbedürftig“. Wer mit mildem Weißbrot, Pasta oder Reis aufgewachsen ist, verbindet den erdigen, leicht bitteren Ton von Buchweizen oft mit „gesund, aber nicht lecker“. Geschmackliche Sozialisation spielt hier eine große Rolle.
Preis und Verfügbarkeit
Buchweizen ist in Mitteleuropa meist nur in Reformhäusern, Bioläden oder als Nischenprodukt im Supermarkt erhältlich – und das zu vergleichsweise hohen Preisen. Wenn die Verfügbarkeit eingeschränkt und das Produkt teurer als gewohnte Grundnahrungsmittel ist, bleibt es ein Spezialartikel statt Alltagsnahrung.

Gesundheitsargument reicht nicht
Obwohl Buchweizen glutenfrei und reich an Mineralstoffen ist, reicht das Gesundheitsargument allein nicht, um ihn massentauglich zu machen. Er bleibt in Europa eher ein Produkt für Gesundheitsbewusste, Veganer:innen oder Menschen mit Zöliakie – nicht aber für den „normalen“ Wocheneinkauf.
Fazit
In Europa wird Buchweizen kaum gegessen, weil er historisch von „wertvolleren“ Lebensmitteln verdrängt wurde, geschmacklich ungewohnt ist und kulturell wenig verankert bleibt. Während er in Osteuropa alltäglich ist, gilt er im Westen nach wie vor als Exot – trotz aller Superfood-Qualitäten.
Das könnte Sie auch interessieren: