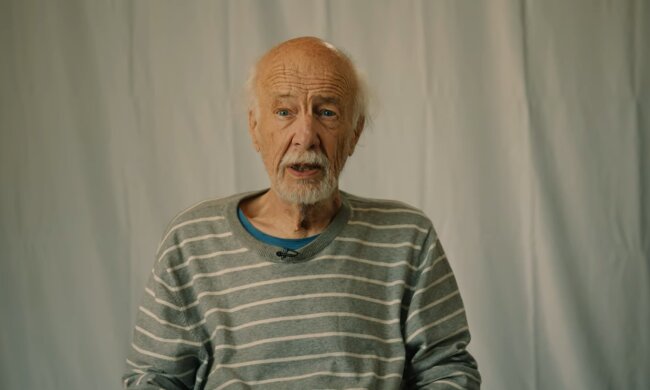In der Kantine des städtischen Verwaltungszentrums herrscht normalerweise reges Treiben. Doch an diesem Morgen wirkt der große Speisesaal ungewohnt leer. Zwischen dampfenden Kaffeekannen und frischen Brötchen steht die Chefin der Kantine, Frau Meier, und schüttelt den Kopf.
„Die Leute wollen heute nicht arbeiten“, sagt sie mit einem leichten Lächeln, das irgendwo zwischen Ironie und Resignation liegt. Was zunächst wie ein Vorwurf klingt, ist in Wahrheit ihre Beobachtung des Tagesgeschehens: Viele Angestellte hätten sich kurzfristig krankgemeldet, andere hätten spontan Homeoffice beantragt.

Für die Kantinencrew bedeutet das: weniger Gäste, weniger Betrieb, weniger Einnahmen. „Wir haben alles vorbereitet, die Suppe köchelt, die Schnitzel liegen in der Pfanne. Und dann kommt keiner. Das ist schon ein bisschen frustrierend“, erzählt Frau Meier.
Gleichzeitig sieht sie den Wandel der Arbeitswelt mit nüchternem Realismus. Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und eine veränderte Einstellung zur klassischen Präsenzpflicht hätten die Kantinenkultur auf den Kopf gestellt. „Früher war die Mittagspause das soziale Herzstück des Arbeitstages. Heute ist sie eher optional – genau wie die Fahrt ins Büro.“
Trotzdem bleibt sie optimistisch: „Wir machen unser Essen mit Liebe, und wer kommt, soll sich hier wohlfühlen. Aber manchmal frage ich mich schon: Wenn keiner mehr ins Büro kommt – brauchen wir dann irgendwann überhaupt noch eine Kantine?“

Ihre Worte sind nicht nur eine Momentaufnahme aus einer Küche, sondern auch ein Spiegelbild größerer gesellschaftlicher Entwicklungen: Wie verändert sich das Arbeiten – und was bedeutet das für die Orte, an denen wir zusammenkommen?
Das könnte Sie auch interessieren: