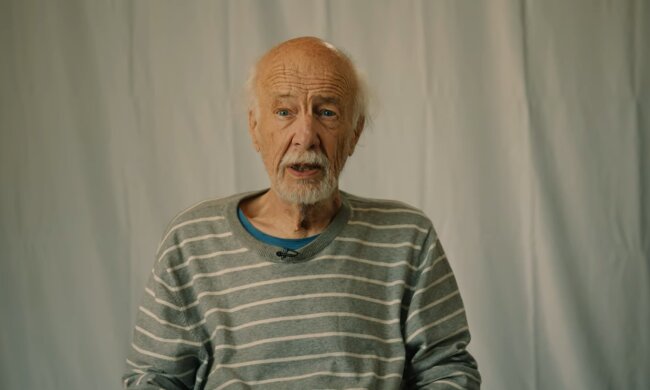Deutschland bereitet sich auf eine große Welle bei der Mindestlohnentwicklung vor: Ab dem 1. Januar 2026 soll der gesetzliche Mindestlohn auf 13,90 Euro brutto pro Stunde angehoben werden. Ein Jahr später, zum 1. Januar 2027, ist eine weitere Erhöhung auf 14,60 Euro geplant.
Diese Reform markiert eine der tiefgreifenden Lohnerhöhungen der letzten Jahre und wird weitreichende Folgen für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die Wirtschaft insgesamt haben.
Warum diese Erhöhung?
Die Mindestlohnkommission — bestehend aus Vertretern von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und unabhängigen Sachverständigen — hat den Vorschlag einstimmig beschlossen. Ziel ist es, den Schutz derjenigen zu stärken, die bislang am Rande des Niedriglohns arbeiten, und eine sozial gerechtere Einkommensverteilung zu fördern. Viele Beschäftigte verdienen aktuell weniger als 13,90 Euro, und diese Erhöhung soll finanzielle Entlastung bringen und zugleich Kaufkraft stärken.

Wer profitiert – und wer zahlt?
Gewinner
-
Niedriglohnbeschäftigte: Schätzungsweise 6 bis 6,6 Millionen Jobs liegen derzeit unterhalb der Marke von 13,90 €. Diese Menschen erhalten ab 2026 eine deutliche Aufbesserung ihres Stundenlohns.
-
Frauen und Ostdeutschland: In diesen Gruppen ist der Anteil von Beschäftigten mit Niedriglöhnen besonders hoch. Für viele könnte diese Anpassung einen spürbaren Unterschied machen.
-
Beschäftigte in Brachen mit niedrigen Tarifen wie Gastronomie, Einzelhandel oder Pflege könnten durch die Erhöhung spürbar entlastet werden.
Belastungen und Herausforderungen
-
Kleine Unternehmen / Handwerksbetriebe tragen das Risiko erhöhter Lohnkosten, die nicht immer vollständig auf Preise oder Produktivität umlegbar sind.
-
Preisanpassungen könnten folgen – etwa in Dienstleistungssektoren, wo bislang Löhne nahe der aktuellen Mindestlohnsätze gezahlt wurden.
-
Minijobs und Übergangsbereiche müssen neu kalkuliert werden: Die Grenze für geringfügige Beschäftigung wird mit der Mindestlohnerhöhung voraussichtlich ansteigen, etwa auf 603 Euro monatlich.
-

-
Bei einigen Unternehmen könnte die Erhöhung zu Rationalisierungen führen oder Anreize, Arbeitsplätze zu reduzieren.
Konkrete Wirkung: Ein Beispiel
Ein Arbeitnehmer, der bisher mit dem Mindestlohn (12,82 €/h) in Vollzeit (ca. 40 Stunden/Woche) arbeitete, würde durch die Erhöhung auf 13,90 € etwa 190 Euro brutto mehr pro Monat erhalten. Und das bedeutet nicht nur mehr Nettolohn, sondern potenziell auch mehr Ausgabenpotenzial (Kaufkraft) für den Alltag.
Das könnte Sie auch interessieren: